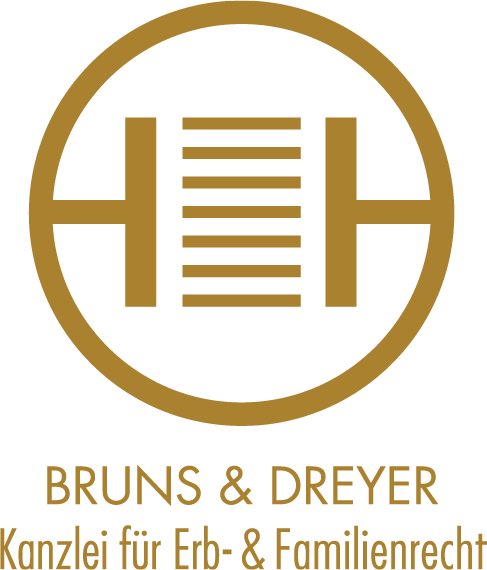§ 2255 BGB – Widerruf durch Vernichtung oder Veränderung
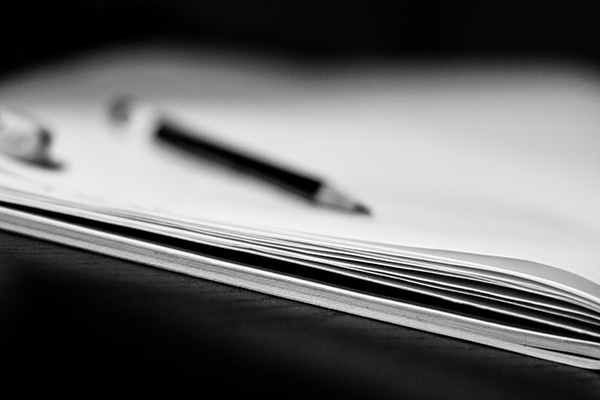
Einleitung:
Wer in der Funktion als Erbe ein Bankschließfach des Erblassers bzw. der Erblasserin öffnen lässt, kann schon einmal eine Überraschung erleben. Manchmal schlummert dort auch ein Testament.
Wie ist mit einem Testament zu verfahren, das zwar in einem Bankschließfach aufbewahrt wird, jedoch entzweigerissen ist? Greift dann die Vermutung, dass der Erblasser dieses Testament widerrufen wollte?
Sachverhalt und Instanzengang:
In dem vorliegenden Fall fanden die aktuelle Ehefrau des Erblassers und der Betreuer der Mutter des Erblassers in einem Bankschließfach desselben ein zerrissenes Testament. Selbiges begünstigte einen Freund und enterbte die vorherige Ehefrau des Erblassers. Besagter Freund wusste nach eigenen Angaben nichts von dem Widerruf des ihn begünstigenden Testaments. Er vertrat folgende Ansicht: Wenn der Erblasser das Testament wirklich hätte zerreißen wollen, hätte er es ganz vernichtet und nicht in dem Schließfach aufbewahrt.
Die Ehefrau des Erblassers und der Betreuer der Mutter des Erblassers verwiesen jedoch darauf, dass sich die Lebensumstände des Erblassers vollständig geändert hätten und kein Zweifel daran bestehe, dass das Testament von dem Erblasser selbst zerrissen worden sei.
Das Nachlassgericht Amtsgericht Eschwege (AG) war der Überzeugung, dass der Erblasser das Testament zerrissen hätte und nach § 2255 Satz 2 BGB die Aufhebung des Testaments anzunehmen sei. Daraufhin erhob der Freund des Erblassers Beschwerde, der das Nachlassgericht nicht abgeholfen hatte. Die Sache gelangte an das Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) zur Entscheidung.
OLG Frankfurt:
Auch das OLG Frankfurt war der Überzeugung, dass der Erblasser zwar ein wirksames Testament errichtet, dieses aber im Sinne des § 2255 BGB durch das Zerreißen widerrufen habe. Für einen Widerruf nach § 2255 Satz 1 BGB sei erforderlich, dass der Wille des Erblassers, seine schriftliche Willenserklärung in Form seines Testaments aufzuheben, zum Ausdruck komme. Das OLG nahm zudem an, dass das Testament nur durch den Erblasser zerrissen worden sein konnte. Einen äußeren mechanischen Einfluss schloss das Gericht aus.
„Auf welche Weise das Testament zerrissen wurde, ist letztlich jedoch unerheblich.Maßgeblich ist, dass das Testament zerstört wurde.“ (S. 4)
Ein Gutachten zu der Ursache der Zerstörung sei daher nicht erforderlich. Der Amtsermittlungsgrundsatz nach § 26 FamFG verpflichte das Gericht vorliegend nicht, da es an konkreten Anhaltspunkten fehle, die das Gericht zu Ermittlungen verpflichte.
„Das Nachlassgericht muss insbesondere nicht allen nur denkbaren Möglichkeiten nachgehen, sondern muss seine Ermittlungen nur soweit ausdehnen, als bei sorgfältiger Überlegung das Vorbringen der Beteiligten und der festgestellte Sachverhalt dazu Anlass geben.“ (S. 4)
So könne nur der Erblasser das Testament zerrissen haben, da nur dieser Zugriff auf das Bankschließfach und das sich dort befindende Testament gehabt habe, was sich mit der durch die Bank eingereichten Unterschriftenkarte zur Benutzung des Schließfaches bestätigen ließe. Anhaltspunkte dafür, dass die Ehefrau des Erblassers ohne Bevollmächtigung durch den Erblasser und ohne Wissen der Bank auf das Schließfach zugegriffen habe, beständen nicht.
„Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine absolute Gewissheit im naturwissenschaftlichen Sinne fast nie zu erreichen und die theoretische Möglichkeit des Gegenteils der Tatsache, die festgestellt werden soll, kaum auszuschließen ist.“ (S. 5)
Dass das Testament beim Öffnungs- oder Schließvorgang beschädigt wurde, hält das OLG für ausgeschlossen. Zudem habe auch die betroffene Angestellte bestätigt, dass das Testament bereits zerrissen in dem Schließfach lag. Das Zerreißen des Testaments durch den Erblasser könne als Testamentswiderruf nach § 2255 BGB angesehen werden.
Auch wenn sich der Sinn, ein zerrissenes Testament in einem Bankschließfach aufzubewahren, nicht erschließe, genüge dies nicht, um die gesetzliche Vermutung zu widerlegen. Dass der Erblasser ein zerrissenes Testament nicht aufbewahrt hätte, sei nur eine Vermutung des Freundes des Erblassers, widerlege jedoch nicht die Vermutung des § 2255 S. 2 BGB. Auch der Partnerinnenwechsel des Erblassers sprach nach Ansicht des OLG dafür, dass das Testament durch den Erblasser mit Widerrufsabsicht zerrissen wurde. Das zerrissene Testament sei somit aufgrund seiner Beschaffenheit als widerrufen anzusehen.
Hinweis:
In dem vorliegenden Fall mag die Annahme eines Widerrufs ohne die entsprechende Amtsermittlung als gerechtfertigt anzusehen sein. Es ist an dieser Stelle jedoch dringend darauf hinzuweisen, dass stets der Einzelfall entscheidend ist. Ausschlaggebend ist der Vernichtungswille des Erblassers. Nur wenn tatsächlich anzunehmen ist, dass der Erblasser die Testamentsurkunde vernichtet oder an ihr Veränderungen vorgenommen hat, die den Willen eine schriftliche Willenserklärung aufzuheben ausdrücken, wird vermutet, dass die Aufhebung und somit der Widerruf des Testaments beabsichtigt war (vgl. § 2255 S. 2 BGB). Und gerade in Bezug auf die Ermittlung des Vernichtungswillens wird wohl auch der Amtsermittlungsgrundsatz nach § 26 FamFG in den meisten Fällen zur Anwendung kommen.
Quellen:
OLG Frankfurt, Beschl. v. 29.04.2025 – 21 W 26/25
Relevante Normen:
§ 2255 BGB – Widerruf durch Vernichtung oder Veränderung
1 Ein Testament kann auch dadurch widerrufen werden, dass der Erblasser in der Absicht, es aufzuheben, die Testamentsurkunde vernichtet oder an ihr Veränderungen vornimmt, durch die der Wille, eine schriftliche Willenserklärung aufzuheben, ausgedrückt zu werden pflegt.
2 Hat der Erblasser die Testamentsurkunde vernichtet oder in der bezeichneten Weise verändert, so wird vermutet, dass er die Aufhebung des Testaments beabsichtigt habe.
Header & Beitragsbild: ©AdobeStock: Ingo Bartussek