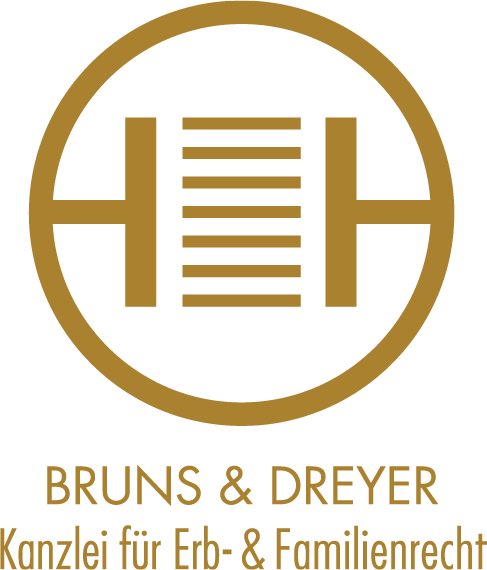§ 2171 BGB – Wirksamkeit eines Vermächtnisses zugunsten des Hausarztes
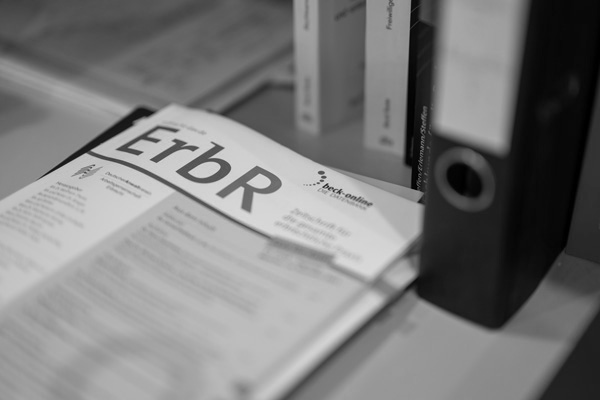
Einleitung:
Wer sich – z.B. im fortgeschrittenen Alter – mit der eigenen (medizinischen) Versorgung beschäftigt, sollte sich auch mit der Frage auseinandersetzen, welche Personen im Falle der Hilfsbedürftigkeit unterstützend zur Seite stehen sollen.
Ist es sittenwidrig, einen Hausarzt oder eine Hausärztin mit bestimmten Tätigkeit zu beauftragen und ihn oder sie im Gegenzug in der letztwilligen Verfügung zu berücksichtigen? Dieser Frage stellte sich das Oberlandesgericht Hamm (OLG) und im Anschluss der Bundesgerichtshof (BGH).
Sachverhalt:
Der Erblasser wurde von seinem Hausarzt medizinisch betreut. Die Beklagte übernahm die Pflegetätigkeit. Im Januar 2016 schloss der Erblasser mit seinem Hausarzt, der Beklagten und deren Tochter einen „Betreuungs-, Versorgungs- und Erbvertrag“. In diesem vereinbarte er unter anderem, dass sein Hausarzt Leistungen zu erbringen habe, die über die rein ärztliche Versorgung hinausgehen. Dafür sollte der Arzt nach dem Tod des Erblassers ein diesem gehörendes Grundstück erben. Über das Vermögen dieses Arztes wurde das Insolvenzverfahren eröffnet.
Der Erblasser errichtete zudem ein notarielles Testament. Nach diesem sollte die Beklagte bezüglich des restlichen Vermögens Alleinerbin werden. Der Insolvenzverwalter nahm die Beklagte auf Übertragung des Grundstücks in Anspruch. Diese hielt die Zuwendung an den Arzt jedoch für sittenwidrig.
OLG Hamm:
Das OLG Hamm nahm an, dass die Beklagte die alleinige Erbin des Erblassers geworden sei. Der Anspruch des Hausarztes aus dem mit dem Erblasser geschlossenen Vertrag sei unwirksam, da er gegen § 32 Abs. 1 S. 1 der Berufsordnung der Ärztekammer Westfalen-Lippe (BO-Ä) verstoße. Durch diesen Verstoß sei eine Teilnichtigkeit der Vereinbarung anzunehmen.
BGH:
Dem widersprach der Bundesgerichtshof (BGH). Das Verbot der BO-Ä richte sich nur an den Arzt bzw. die Ärztin, jedoch nicht an den Patienten bzw. die Patientin. Dies sei schon an dem Wortlaut der Vorschrift erkennbar. Sinn und Zweck der Vorschrift sei es, „das Ansehen und die Integrität der Ärzteschaft“ (Rn. 14) zu sichern und nicht das Erbrecht von etwaigen Patientenangehörigen zu schützen.
„Von Patienten Geschenke oder andere Vorteile zu fordern, sich versprechen zu lassen oder anzunehmen, ist Ärzten schon nach dem Wortlaut des § 32 Abs. 1 Satz 1 BO-Ä nur untersagt, wenn hierdurch der Eindruck erweckt wird, dass die Unabhängigkeit der ärztlichen Entscheidung beeinflusst wird. Weil insoweit Zweifel an der Unabhängigkeit aus der Sicht eines objektiven Beobachters genügen, schützt das Verbot nicht nur die konkrete Unabhängigkeit des Arztes, sondern auch das abstrakte Vertrauen der Allgemeinheit in die Freiheit und Unabhängigkeit ärztlicher Entscheidungen […].“ (Rn. 14)
Eine Zuwendung von Todes wegen zugunsten des Hausarztes sei mit dem Ansehen und der Integrität der Ärzteschaft jedoch vereinbar. Ein etwaiges an den Arzt gerichtetes Verbot könne schließlich durch berufsrechtliche Sanktionen sichergestellt werden. Weiterhin sei die Testierfreiheit des Patienten zu berücksichtigen. Zwar könne die Testierfreiheit durch die §§ 134, 2171 Abs. 1 BGB beschränkt werden – jedoch nur in verhältnismäßigem Umfang zur Verfolgung eines legitimen Zwecks. Allerdings fehle es hier schon an der Ermächtigungsgrundlage für die Beschränkung der Testierfreiheit durch die Ärztekammer. Schließlich solle § 32 Abs. 1 S. 1 BO-Ä den zuwendenden Patienten bzw. die zuwendende Patientin schützen. Eine Unwirksamkeit der letztwilligen Verfügung – und somit ein Eingriff in die Testierfreiheit – ließe sich nicht mit § 32 Abs. 1 S. 1 BO-Ä rechtfertigen. Auch läge keine Unwirksamkeit aufgrund eines Verstoßes gegen eine Strafvorschrift vor. So sei auch die Annahme einer zur Nichtigkeit führenden Sittenwidrigkeit nicht gegeben. Zwar bestände grundsätzlich die Möglichkeit, dass eine letztwillige Verfügung im Nachhinein – also nach dem Zeitpunkt der Errichtung – gegen die guten Sitten verstoße, und somit der Vermächtnisanspruch gemäß Treu und Glauben nicht geltend gemacht werden könne – ein solcher Fall sei jedoch vorliegend nicht gegeben. Die Entscheidung wurde an das OLG Hamm zurückverweisen, welches auch die Parteien erneut zu dem Fall vortragen lassen solle.
Fazit:
Somit ist in dem vorliegenden Fall das entscheidende Kriterium bei der Beurteilung, ob durch die letztwillige Verfügung des Patienten gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen wurde, die Wahrung der ärztlichen Unabhängigkeit und die Wahrung der Integrität der Ärzteschaft. Daraus kann abgeleitet werden, dass eine Berücksichtigung des Hausarztes unter Vereinbarung entsprechender Gegenleistungen in einer letztwilligen Verfügung nicht per se zu deren Unwirksamkeit führt.
Quellen:
BGH, Urt. v. 02.07.2025 – IV ZR 93/24
Relevante Normen:
§ 2171 BGB – Unmöglichkeit, gesetzliches Verbot
(1) Ein Vermächtnis, das auf eine zur Zeit des Erbfalls für jedermann unmögliche Leistung gerichtet ist oder gegen ein zu dieser Zeit bestehendes gesetzliches Verbot verstößt, ist unwirksam.
[…]