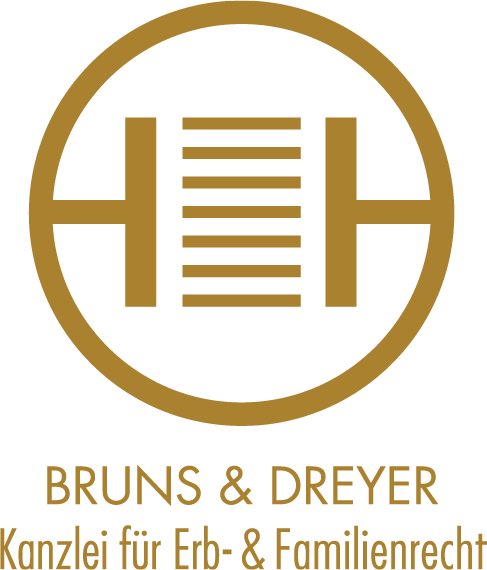§ 1567 BGB – Getrenntleben der Eheleute trotz gemeinsamer Wohnung

Einleitung:
Nach § 1565 BGB kann eine Ehe geschieden werden, wenn die Eheleute ein Jahr getrennt leben. § 1567 Abs. 1 BGB beschreibt, wie dieses „getrennte Leben“ auszusehen hat: Nach § 1567 Abs. 1 BGB leben die Ehegatten getrennt, wenn zwischen ihnen objektiv keine häusliche Gemeinschaft mehr besteht. Subjektiv muss zumindest ein Ehepartner die häusliche Gemeinschaft auch nicht mehr herstellen wollen, da er die eheliche Lebensgemeinschaft ablehnt.
Sachverhalt:
Im vorliegenden Sachverhalt lebten die Ehegatten trotz Trennung weiterhin in ein- und derselben Wohnung. Ferner wurden in der ehemaligen Ehewohnung gemeinsame Mahlzeiten der Ehegatten mit den noch minderjährigen Kindern eingenommen – zum Wohle der Kinder. Weiterhin erwiesen sich die Eheleute hin und wieder geringfügige wechselseitige Handreichungen. Als Trennungszeitpunkt könnte folglich der Zeitpunkt der Absendung einer E-Mail seitens der Ehegattin anzusehen sein. In dieser schrieb sie ihrem Mann, dass es für alle besser sei, wenn sie getrennt lebten. Etwa anderthalb Monate nach dieser E-Mail zog die Antragstellerin aus der gemeinsamen Ehewohnung aus. Auch dieser Auszug käme als Indikator für die Trennung und somit als Trennungszeitpunkt in Betracht. Hinsichtlich der Feststellung des Trennungszeitpunkts zwecks der Unterhaltsberechnung waren sich die Parteien nun uneinig. Das Amtsgericht Frankfurt (AG) legte den Auszug der Ehegattin als Trennungszeitpunkt fest.
OLG Frankfurt:
Das Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) erläuterte daraufhin, dass der Trennungszeitpunkt nach den Voraussetzungen des § 1567 BGB zu bestimmen sei. Hinsichtlich der objektiven Voraussetzungen führte das OLG aus, sei es nicht notwendig, dass ein Ehegatte aus der Wohnung ausziehe, da gemäß § 1567 Abs. 1 S. 2 BGB eine häusliche Gemeinschaft auch dann nicht mehr bestehe, wenn die Ehegatten innerhalb der ehelichen Wohnung getrennt lebten. Das anzustrebende Höchstmaß der Trennung verlange, dass die Eheleute getrennt wohnten und schliefen, so dass ihr Getrenntleben so nach außen erkennbar sei. Darüber hinaus dürften die Ehegatten keinen gemeinsamen Haushalt mehr führen und es dürfe zwischen ihnen keine wesentliche persönliche Beziehung mehr bestehen. Die strenge Handhabung der objektiven Voraussetzungen schränkt das OLG Frankfurt jedoch ein:
„Zwar ist hier grundsätzlich ein strenger Maßstab anzulegen, jedoch hindern vereinzelt bleibende Versorgungsleistungen bzw. Handreichungen der Ehegatten füreinander ohne besondere Intensität oder Regelmäßigkeit ein Getrenntleben nicht; auch muss ein freundschaftlicher, anständiger und vernünftiger Umgang der Ehegatten miteinander nicht ausgeschlossen sein […].“ (S. 6)
Dies rechtfertigt das OLG vor allem mit dem Kindeswohl. Lebten gemeinsame Kinder im Haushalt, blieben die Ehegatten – wie sich aus § 1684 Abs. 2 BGB ergäbe – auch nach der Trennung zum Wohl der Kinder „zum Wohlverhalten verpflichtet“ (S. 6). Gerade die gemeinsame Einnahme von Mahlzeiten und ein freundlicher Umgang ständen der Annahme eines Getrenntlebens nicht entgegen. Ob eine Gemeinschaft oder ein Getrenntleben anzunehmen sei, hänge entscheidend von dem vorherigen Zusammenleben ab. Sollte die Auflösung der häuslichen Gemeinschaft auch subjektiv zu beurteilen sein, so sei zudem abzuwägen, ob eine Wiederherstellung der Lebensgemeinschaft der Ehegatten erwartet werden könne.
Vorliegend ist nach Ansicht des OLG Frankfurt ein Getrenntleben der Ehegatten schon vor dem Auszug der Ehegattin anzunehmen. Da der Ehegatte den Keller als Schlafzimmer und das dortige Badezimmer allein nutzte, die anderen Räumlichkeiten des Hauses nicht mehr gemeinschaftlich genutzt wurden und von den Ehegatten keine Intimitäten untereinander ausgetauscht wurden, sei die Trennung auch nach außen erkennbar gewesen. Vereinzelte Gefälligkeiten und ein höflicher Umgang vor und mit den Kindern seien dabei ob ihres geringen Ausmaßes unbeachtlich und dem gesellschaftlichen Anstand zuzuschreiben. In subjektiver Hinsicht habe die Ehegattin durch ihre E-Mail (und die vorangegangene Kommunikation) deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie die häusliche Lebensgemeinschaft nicht wieder herstellen wollte.
Fazit:
Die Ablehnung der ehelichen Lebensgemeinschaft ist folglich entscheidend für die Annahme eines „getrennten Lebens“. Eine häusliche Gemeinschaft ist daher nicht in jedem Fall ein Indiz für eine eheliche Gemeinschaft – vor allem dann nicht, wenn diese vornehmlich aufgrund der Kinder aufrechterhalten wird.
Quelle: OLG Frankfurt, Beschl. v. 28.03.2024 – 1 UF 160/23
Relevante Norm:
§ 1567 BGB – Getrenntleben
(1) Die Ehegatten leben getrennt, wenn zwischen ihnen keine häusliche Gemeinschaft besteht und ein Ehegatte sie erkennbar nicht herstellen will, weil er die eheliche Lebensgemeinschaft ablehnt. Die häusliche Gemeinschaft besteht auch dann nicht mehr, wenn die Ehegatten innerhalb der ehelichen Wohnung getrennt leben.
(2) […]
©AdobeStock: Beitragsbild: U-JAlexander