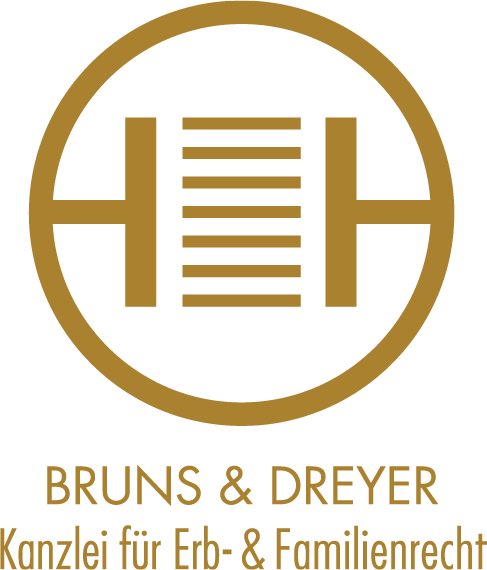§ 2268 BGB – Wirkung der Ehescheidung auf Verfügung zugunsten Dritter
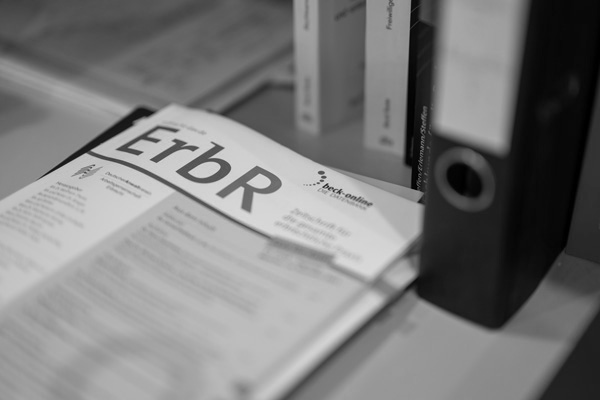
Einleitung:
Das Oberlandesgericht Zweibrücken (OLG) beschäftigte sich kürzlich mit der Frage, ob die Verfügung zugunsten eines Dritten innerhalb eines vor der Ehe geschlossenen Erbvertrages im Falle einer späteren Scheidung unwirksam sei. Der § 2077 BGB hier eine entscheidende Rolle.
Sachverhalt:
Der Erblasser schloss mit seiner Partnerin aufgrund der bevorstehenden Heirat einen „Ehe- und Erbvertrag“. In diesem wurde die Tochter der Partnerin als alleinige Erbin eingesetzt. Die später zwischen dem Erblasser und seiner Partnerin geschlossene Ehe wurde fünf Jahre nach dem Vertragsschluss wieder geschieden.
Nach dem Tod des Erblassers beantragte die Tochter der vorverstorbenen Schwester des Erblassers die Erteilung eines Erbscheins. Dieser sollte sie als Alleinerbin des Erblassers ausweisen. Ihrer Ansicht nach sei die Einsetzung der Tochter der vorherigen Partnerin des Erblassers aufgrund der späteren Scheidung unwirksam geworden. Die Tochter der vorherigen Partnerin des Erblassers trat diesem Erbschein entgegen. Sie vertrat die Auffassung, dass ihre Einsetzung als Alleinerbin in dem Erbvertrag weiterhin wirksam sei.
AG Kaiserslautern:
Das Nachlassgericht – Amtsgericht Kaiserslautern (AG) – hat den Erbschein der Tochter der vorverstorbenen Schwester abgewiesen und eine wirksame Erbeinsetzung der ehemaligen Partnerin des Erblassers angenommen. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Tochter der vorverstorbenen Schwester des Erblassers.
OLG Zweibrücken:
Das OLG Zweibrücken widerspricht dem AG Kaiserslautern, und somit der Ansicht, dass sich vorliegend die Erbfolge nach dem Erbvertrag richte. Der Erbvertrag der Eheleute sei durch die erfolgte Scheidung unwirksam geworden. Daher sei hier die gesetzliche Erbfolge entscheidend.
§ 2268 Abs. 1 BGB, der nach § 2279 Abs. 1 BGB auch auf vertragsmäßige Zuwendungen und Auflagen anwendbar sei, bestimme, dass ein gemeinschaftliches Testament in den Fällen des § 2077 BGB – „Unwirksamkeit letztwilliger Verfügungen bei Auflösung der Ehe oder Verlobung“ – grundsätzlich seinem ganzen Inhalt nach unwirksam sei. Zudem verweise § 2279 Abs. 2 BGB ausdrücklich darauf, dass § 2077 BGB auch für Eheverträge zwischen Ehegatten, Lebenspartnern oder Verlobten gelte, sofern darin ein Dritter bedacht sei. Eine etwaige Wechselseitigkeit der Verfügung sei hierbei irrelevant. So liege es in der Natur des Erbvertrages, dass gerade nicht vorausgesetzt würde, dass die Vertragsschließenden wechselseitige Verfügungen träfen.
Bei der Einsetzung der Tochter der ehemaligen Partnerin des Erblassers liege eine vertragsmäßige Verfügung und keine einseitige Verfügung des Erblassers vor. Dass der Erblasser sich innerhalb des Vertrages den jederzeitigen Rücktritt vorbehielt, ändere an der Annahme eines Erbvertrages nichts. So sähe § 2293 BGB explizit eine solche Lockerung der Bindungswirkung durch einen Rücktrittsvorbehalt vor. Der Rücktrittsvorbehalt ergäbe wiederum nur bei vertragsmäßigen Verfügungen einen Sinn. Zudem müsse berücksichtigt werden, dass es sich vorliegend um eine notarielle Urkunde, also eine Urkunde eines fachkundigen juristischen Dritten handele.
„Somit ist gemäß §§ 2279 Abs. 2, 2077 Abs. 1 BGB infolge der späteren Scheidung des Erblassers von der Mutter der Beteiligten zu 2) grundsätzlich auch die in dem Erbvertrag durch den Erblasser erfolgte Einsetzung der Beteiligten zu 2) als alleinige Erbin unwirksam geworden.“ (Rn. 30)
Es könne gerade nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass der Erblasser eine Erbeinsetzung der Tochter der ehemaligen Ehefrau auch nach der Scheidung gewollt hätte. Denn der Erbvertrag wurde schließlich aufgrund der bevorstehenden Heirat geschlossen. Es kann auch kein besonderes „Vater-Tochter-Verhältnis“ bei Vertragsschluss angenommen werden. Ferner könne unterstellt werden, dass der Erblasser nach der Scheidung verständlicherweise keinen Rücktritt von dem Erbvertrag erklärte, da er sich darauf hätte verlassen können, dass die Auflösung der Ehe auch die Unwirksamkeit des Erbvertrages zur Folge habe.
„Der Umstand, dass der Erblasser auch nach der erfolgten Scheidung einen ausdrücklichen Rücktritt vom Erbvertrag gegenüber seiner geschiedenen Frau/Mutter der Beteiligten zu 2) nicht erklärt hat, besagt schließlich nicht, dass er die Erbeinsetzung der Beteiligten zu 2) bei Abschluss des Erbvertrages auch für den Fall der Auflösung der Ehe gewollt hätte. […] Zu einem „einfachen Rücktritt“ durch ein Testament gemäß § 2297 BGB wäre der Erblasser dagegen erst nach dem Tod der Mutter der Beteiligten zu 2) berechtigt gewesen.“ (Rn. 34)
Folglich ist die Tochter der vorverstorbenen Schwester des Erblassers nach gesetzlicher Erbfolge Alleinerbin des Erblassers geworden.
Fazit:
Grundsätzlich ist also für den Fall der Ehescheidung die Unwirksamkeit einer erbvertraglichen Einsetzung eines Dritten anzunehmen. Gegebenenfalls hätte hier ein ausführlicher und begründeter Vortrag der Tochter der ehemaligen Partnerin des Erblassers zu einem besonderen „Vater-Tochter-Verhältnis“ bei Vertragsschluss die Ansicht des OLG Zweibrücken geändert. (vgl. explizit Rn. 33)
Ohne einen solchen Vortrag oder weitere (andere) Anhaltspunkte zu einem etwaigen Wunsch des Erblassers bezüglich der Wirksamkeit der erbvertraglichen Verfügung zugunsten der Tochter auch nach der Ehescheidung, ist jedoch eine Unwirksamkeit der erbvertraglichen Einsetzung ab Ehescheidung anzunehmen.
Quellen:
OLG Zweibrücken, Beschl. v. 10.03.2025 – 8 W 19/24
Relevante Normen:
- § 2268 BGB – Wirkung der Ehenichtigkeit oder -auflösung
(1) Ein gemeinschaftliches Testament ist in den Fällen des § 2077 seinem ganzen Inhalt nach unwirksam.
(2) […].